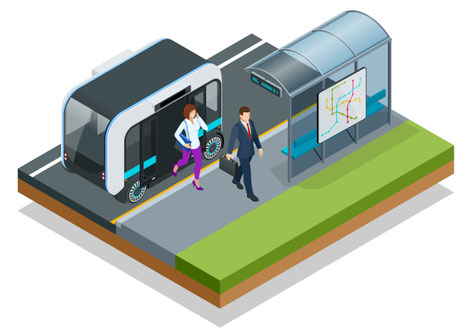
Autonomes Fahren ist seit Jahrzehnten als moderne Mobilitätsoption und ökologischer Problemlöser im Gespräch. Bislang mangelte es an der Umsetzung. Ein ÖPNV-Pilotprojekt in Baden-Württemberg schaffte erstaunliche Akzeptanz in der Bevölkerung, während sich Anbieter wie Baidu und Waymo etablieren. Tesla könnte den Anschluss verpassen.
Nach mehr als vier Jahren ist das Forschungsprojekt „Reallabor für den automatisierten Busbetrieb im ÖPNV in der Stadt und auf dem Land“ (RABus) zu Ende gegangen. Ergebnis: Autonome ÖPNV-Shuttles funktionieren nicht nur im normalen Straßenverkehr, sondern erfahren auch eine breite Akzeptanz.
Das Projekt RABus war für das Land Baden-Württemberg ein wichtiger Baustein, um seine Strategie zur automatisierten und vernetzten Mobilität umzusetzen. Das wollte man durch Reallabore erreichen, die zeigen, wie automatisierter Nahverkehr in Stadt und Land funktionieren kann. Ziel des Projekts war es, den öffentlichen Nahverkehr flexibler, barrierefreier und zugänglicher zu machen – mit dem Fokus auf Randgebiete und ländliche Regionen. Beteiligt waren das Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeugmotoren Stuttgart (FKFS), Stadtverkehr Friedrichshafen (SVF), Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB), Rhein-Neckar-Verkehr (rnv), das Institut für Verkehrswesen (IfV) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) sowie Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen.
Autonomes Fahren, das gilt zumindest für Europa, macht nur Sinn als Teil des ÖPNV, das heißt als Form kollektiver Mobilität.
RABus hatte im Herbst 2023, nach der Novellierung des Straßenverkehrsgesetzes, eine der bundesweit ersten Erprobungsgenehmigungen des Kraftfahrtbundesamtes zur Datenaufzeichnung und Hardware-Erprobung erhalten. Seit Oktober 2024 lief der Praxistest des Projekts RABus. Im Rahmen dessen beförderten dabei in Mannheim und Friedrichshafen je zwei schwarz-gelbe, autonome Shuttles im Testbetrieb regelmäßig Probanden. Insgesamt fanden 430 Testfahrten statt, in denen 1.600 Teilnehmer transportiert und 2.100 Kilometer auf öffentlichen Straßen zurückgelegt wurden. Das Fazit der Testphase fiel positiv aus: 99 Prozent der Fahrten ließen sich nach Fahrplan umsetzen – selbst bei Regen, Nebel oder zähflüssigem Verkehr. Die Fahrzeuge bremsten den Verkehrsstrom nicht aus, sondern reihten sich flüssig ein.
Wichtiges Ziel erreicht: mehr öffentliches Vertrauen
Im Rahmen einer landesweiten Potenzialanalyse konnten in nahezu jeder Gemeinde Baden-Württembergs konkrete Anwendungsfälle zur Ergänzung des ÖPNV identifiziert werden. Gleichzeitig wurde ein zentraler Markstein für die Zukunftstechnologie erreicht – das Vertrauen der Öffentlichkeit zu gewinnen: 93 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich während der Fahrt sicher gefühlt haben. Durch die Testfahrten konnten die Teilnehmer ihre Bedenken abbauen und Vertrauen aufbauen. Ein deutliches Zeichen, dass die Akzeptanz für autonome Shuttles wächst. Während 40 Prozent der Befragten vor der Fahrt angaben, Vorbehalte gegenüber dem automatisierten Fahren zu haben, hatte sich diese Gruppe nach der Fahrt halbiert. Einen wichtigen Beitrag dazu soll die Fahrbegleitung beigetragen haben. Auch Komfortaspekte – etwa das großzügige Platzangebot im Fahrzeug – wurden von den Teilnehmenden sehr positiv hervorgehoben.
Waymo im Westen die Nummer 1
Derzeit betreibt die Google-Schwester Waymo den einzigen Robotaxidienst der Welt, der sich nicht mehr im Teststadium befindet. Das Wachstum ist rasant: Der Marktanteil im Taxisegment in San Francisco soll dem Investor Andreessen Horowitz zufolge bereits im vergangenen November, also vier Monate nach dem Start, über 22 Prozent betragen haben. Zuletzt meldete das Unternehmen 250.000 bezahlte Fahrten pro Woche.
Das Geschäft von Baidus Robotaxi-Tochter Apollo könnte schon bald massiv Fahrt aufnehmen. Die chinesische Hauptstadt Peking hatte kürzlich angekündigt, die Regeln für Robotaxis zu lockern. Baidu ist eigentlich Chinas Marktführer im Bereich Internetsuche, investiert jedoch massiv in generative KI und autonomes Fahren.
Für Baidu wäre eine wachsende Robotaxi-Sparte ein Befreiungsschlag. Wegen der anhaltend schwachen Werbekonjunktur hat das Geschäft des Suchmaschinenriesen gelitten. Dagegen soll die Baidu-Tochter Apollo Go schon im kommenden Jahr profitabel sein, zudem wurde angekündigt, dass die autonome Flotte mit Hochdruck weiter ausgebaut wird.
Aktuell testet das Unternehmen seine selbstfahrenden Taxis in elf chinesischen Städten, darunter Peking, Wuhan, Shenzhen und Shanghai. Die Robo-Autos sind im Allgemeinen billiger als Taxis. Ganz selbstbestimmt fahren die Robotaxis aktuell jedoch noch nicht. Auch der Richtlinienentwurf des Pekinger Amts für Wirtschaft und Informationstechnologie sieht vor, dass autonome Fahrzeuge während des Betriebs von Robotaxis einen Fahrer oder Sicherheitsbeauftragten an Bord haben oder aus der Ferne gesteuert werden können.
VW kooperiert mit Uber
Erst vor wenigen Wochen haben Volkswagen und der US-Fahrtenvermittler Uber ihre ambitionierten Ziele vorgestellt: In zehn Jahren soll eine Flotte von Tausenden vollautonomen ID.Buzz, dem elektrischen VW-Bus im Retro-Stil, auf den Straßen mehrerer US-Städte unterwegs sein. Los geht es im kommenden Jahr in Los Angeles. Die Technologie dafür entwickelt die Volkswagen-Tochter Moia. Die Fahrten werden die Kunden über die Plattform von Uber buchen.
Noch ist unklar, wer das Robotaxi-Rennen gewinnen könnte. Waymo führt in den USA derzeit den autonomen Pkw-Markt an. Aber gerade im Logistikbereich treten weitere Anbieter in Erscheinung. So testet Aurora in Texas bereits fahrerlose Lkw. Auch die Daimler-Truck-Tochter Torc ist auf diesem Gebiet aktiv. Überraschend: Tesla sehen Insider trotz des Vorsprungs durch Fahrdaten Hunderttausender verkaufter Tesla-Autos kurzfristig nicht als potenziellen Marktführer. Der Grund: Tesla nutze nicht alle gesammelten Daten, sondern verwende nur ausgewählte Segmente für das KI-Training.
Los Angeles plant die Olympischen Spiele 2028 als „No Car Games“ zu gestalten und setzt stark auf den öffentlichen Nahverkehr, um den Verkehrskollaps zu vermeiden. Deshalb möchte die Stadt den privaten Autoverkehr während der Spiele weitgehend unterbinden und setzt stattdessen auf ein umfassendes ÖPNV-Netzwerk. Dies soll die Nutzung von Robotaxis oder autonomen Shuttles einschließen.
